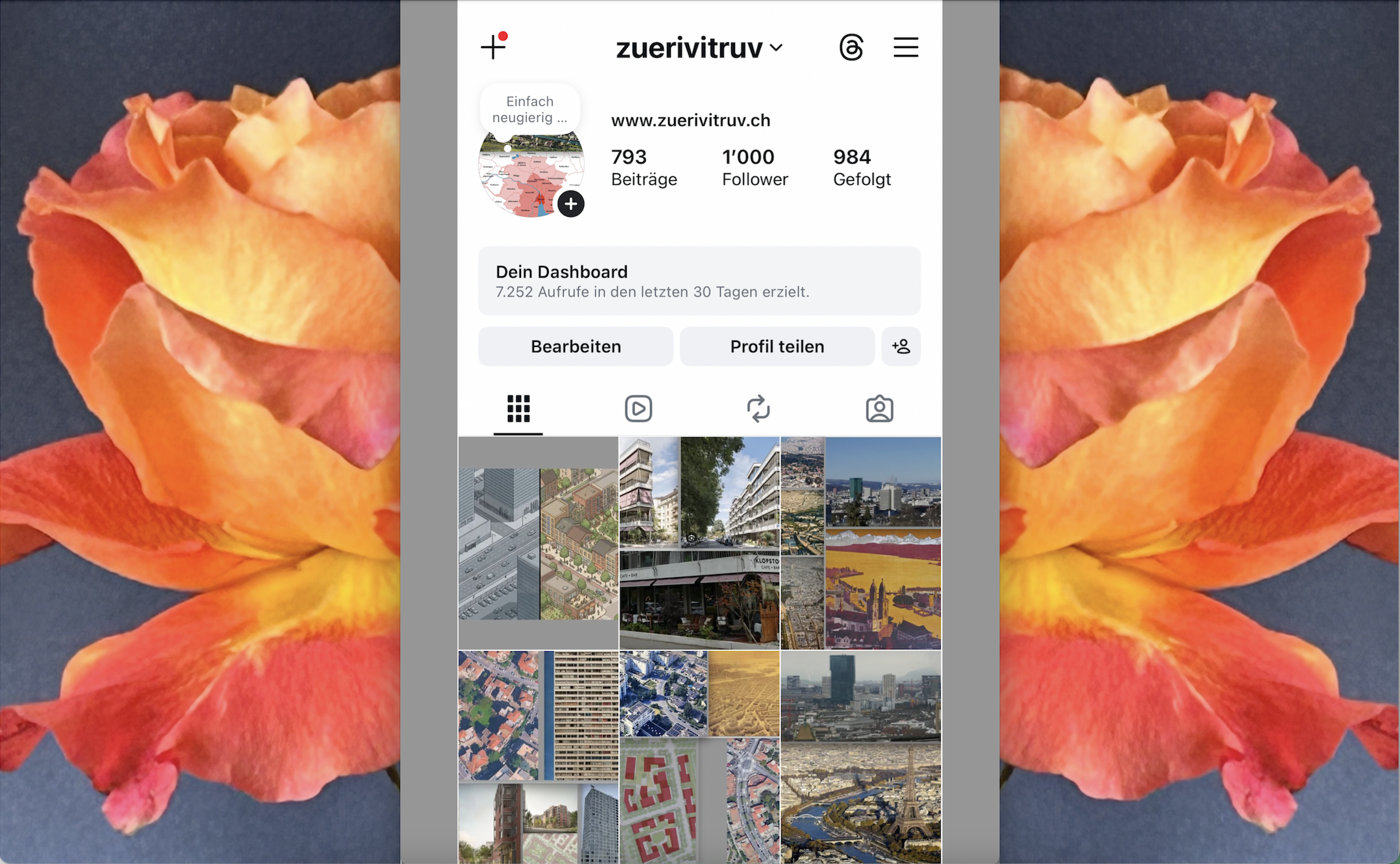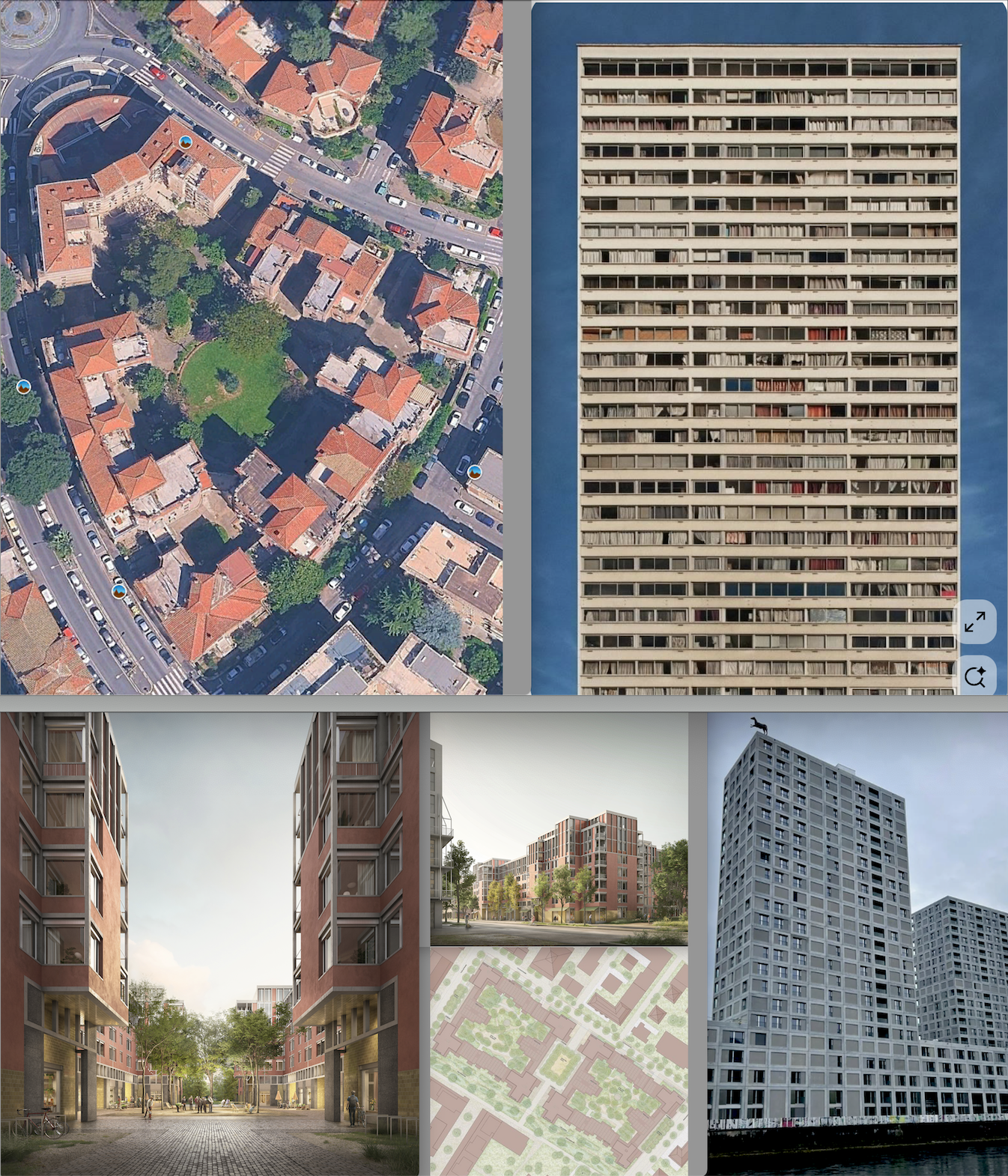Vor vier Tagen endete der zweiteilige Rückblick auf das Jahr 2025. Das Fernrohr ins Jahr 2026 zeigt die unbändige Kraft eines Pferds, aber auch die Kühnheit des Cowboys, der sich nicht abwerfen lässt. «zuerivitruv» sieht heute keine bessere Metapher für das kommende Jahr und die kommende vierjährige Legislatur. Wäre «zuerivitruv» Regisseur, würde die Rolle des wilden Pferds mit den Grossimmos besetzt und die des tapferen Cowboys mit unserer Stadtverwaltung.
Darum herum rankt sich viel Schicksalshaftes, wie der Abschluss der Beratungen der Gemeinderatskommission über die neuen Hochhausrichtlinien und das Resultat der Wahlen mit Erneuerung im Stadt- und Gemeinderat. Für uns von Interesse ist das freiwerdende Stadtpräsidium mit dem Ressort «Stadtentwicklung» und das ebenfalls freiwerdende Hochbaudepartement mit dessen «Amt für Städtebau». Die Spannung ist nach schwachen Jahren des Cowboys gross, die Erwartung hoch.
Um gleich klarzustellen: Beide Akteure sollen mehr als überleben, beide sind die wesentlichen Kräfte der Stadtentwicklung. Es geht um ein erfolgreiches Zusammenraufen mit dem Ziel, die Stadt im weiteren Wachstum in jeder Hinsicht zu verbessern. Der praktische Teil besteht bis zu den Wahlen vom 8. März darin, Kandidaten und Kandidatinnen, die unsere nächste Zukunft gestalten, schonungslos zu prüfen. Wir fordern im Rodeo der Kräfte eine starke Stadt. Dürfen wir hoffen, dass die Presse uns hilft und in den kommenden Interviews die relevanten Fragen stellt?
Wir wollen den Gesamtstadtrat als Team in der aktiven Entwicklung einer guten Zukunft sehen. Dann sind wir auch gerne bereit, nach unseren individuellen Möglichkeiten beizutragen. Wir wollen erleben, wie Gestaltungsfreude den kleinen Zank überflügelt.